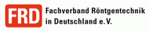Technische Innovationen in der Pflege –

Technische Innovationen in der Pflege –
Handlungsempfehlungen für die erfolgreiche Implementierung
Uwe Bettig (Hrsg.) medhochzwei Verlag 2024 ISBN: 978-3-98800-091-0
In einer Zeit, in der Digitalisierung zunehmend Einzug in alle Lebensbereiche halten, steht auch die Pflegebranche vor großen Herausforderungen und Chancen. Das Buch „Technische Innovationen in der Pflege – Handlungsempfehlungen für die erfolgreiche Implementierung“, herausgegeben von Uwe Bettig bietet mit sieben Beiträgen von Experten aus Wissenschaft und Praxis einen fundierten Überblick in die Potenziale und Hürden digitaler Technologien in der Pflege. Der Sammelband vereint wissenschaftliche und praxisnahe Perspektiven, um Wege zur erfolgreichen Einführung von Innovationen aufzuzeigen und unterschiedliche Aspekte der Digitalisierung in der Pflege zu beleuchten – von grundlegenden Überlegungen bis hin zu konkreten Praxisbeispielen.
Einleitend skizziert Herbert Schirmer in seinem Beitrag Chancen und Grenzen der Digitalisierung in der Pflege, dass die Einführung neuer Technologien nicht nur technische, sondern auch wirtschaftliche, politische und ethische Fragestellungen mit sich bringt. Er argumentiert, dass eine verstärkte Digitalisierung sowie die Akademisierung des Pflegepersonals dazu beitragen können, den Fachkräftemangel zu entschärfen. Dabei beleuchtet er verschiedene Versorgungsformen wie die teilstationäre, ambulante und häusliche Pflege sowie die Palliativpflege. Gleichzeitig benennt er bestehende Hürden, darunter Interoperabilitätsprobleme, mangelnde Einbindung von Pflegekräften in digitale Planungsprozesse sowie Defizite bei der Telemedizin und Datensicherheit.
Themen wie die elektronische Patientenakte (ePA), das E-Rezept sowie der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) und Robotik erfordern eine gezielte Vorbereitung der Anwender, um Akzeptanz und effektive Nutzung sicherzustellen. Insbesondere im ländlichen Raum könnten digitale Assistenzsysteme den Personalmangel kompensieren. So ermöglichen medizinische Versorgungsassistenten die Vitalparameter von Patienten in deren häuslichen Umgebung digital zu erfassen und Fachärzte per Videokonferenz hinzuzuziehen – vorausgesetzt, es existiert eine flächendeckende Breitbandinfrastruktur. Auch innovative Anwendungen wie Mobile Health und sensorbasierte Wearables bieten großes Potenzial für die pflegerische Nachsorge und die Entlastung des Personals. KI-Technologien könnten zudem zukünftig Diagnosen unterstützen und administrative Abläufe effizienter gestalten.
Ein wertvoller Aspekt des Buches ist die Verbindung theoretischer Konzepte mit praktischen Anwendungen. So analysieren Bianka Grau und Madlen Lippeck die Einführung der ePA in der Johannesstift Diakonie. Ihr Fallbeispiel verdeutlicht, wie digitale Lösungen erfolgreich implementiert werden können, welche Herausforderungen dabei seit 2017 auftraten und welche Rolle Pflegekräfte in diesem Transformationsprozess spielen sollten.
Saskia Ehrenfried untersucht die Auswirkungen sensorgestützter Pflegeinformationstechnologien auf die stationäre Altenpflege. Ihre Arbeit zeigt sowohl positive Effekte als auch die Skepsis vieler Pflegekräfte gegenüber technologischen Veränderungen. Die qualitative Interviewstudie liefert hilfreiche Einblicke in die Praxis und betont, dass der Erfolg digitaler Transformationen maßgeblich von der Akzeptanz und Weiterbildung der Mitarbeiter abhängt.
Weitere Kapitel widmen sich den Schnittstellen im geriatrischen Versorgungsprozess, der Integration digitaler Gesundheits- (DiGA) und Pflegeanwendungen (DiPA) sowie den Erfolgsfaktoren für nachhaltige Verbesserungen in der Pflege durch technologische Innovationen.
Ein zentrales Thema ist zudem die Regelfinanzierung von Pflegeinnovationstechnologien, die von Bettig, Ehrenfried und Knuth beleuchtet wird. Sie analysieren die finanziellen und regulatorischen Herausforderungen bei der Einführung neuer Technologien und stellen Lösungsansätze vor.
Das abschließende Kapitel von Heidemarie Hille konzentriert sich auf die Erfolgsfaktoren für die Implementierung neuer Technologien. Hier wird deutlich, dass interdisziplinäre Zusammenarbeit und eine sorgfältige Prozessanalyse entscheidend für den nachhaltigen Erfolg digitaler Lösungen in der Pflege sind.
Kritik:
Eine der größten Stärken des Buches liegt in seiner interdisziplinären Herangehensweise. Die Beiträge stammen nicht nur aus der Pflegewissenschaft, sondern auch aus den Bereichen Gesundheitsökonomie, Informatik und Ethik. So entsteht ein umfassendes Bild der Digitalisierung in der Pflege, das technische, menschliche und organisatorische Aspekte gleichermaßen berücksichtigt. Allerdings wäre eine noch tiefere Auseinandersetzung mit den ethischen Herausforderungen der digitalen Transformation wünschenswert gewesen.
Hervorzuheben ist auch die praxisnahe Ausrichtung des Buches. Neben theoretischen Überlegungen liefert es konkrete Handlungsempfehlungen und Best-Practice-Beispiele. Allerdings könnte die teilweise sehr wissenschaftliche Sprache den Zugang für Praktiker erschweren. Insbesondere für die kleineren Pflegeeinrichtungen wären praxisnahe Ratschläge zur Umsetzung nützlich gewesen. Zudem hätte ein Vergleich mit internationalen Erfahrungen eine wertvolle Ergänzung bedeutet.
Fazit:
Technische Innovationen in der Pflege ist ein wichtiges und zeitgemäßes Werk, das die digitale Transformation aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet. Es bietet wertvolle Impulse für Pflegekräfte, Wissenschaftler und Entscheidungsträger, die sich mit der Einführung technischer Innovationen auseinandersetzen, so auch die Verantwortlichen von Krankenhaustechnik, IT und Medizintechnik. Durch die praxisnahe Darstellung und die wissenschaftlich fundierte Analyse leistet das Buch einen wertvollen Beitrag zur Debatte über die Zukunft der Pflege in einer zunehmend digitalisierten Welt.
Manfred Kindler, mt 2.2025